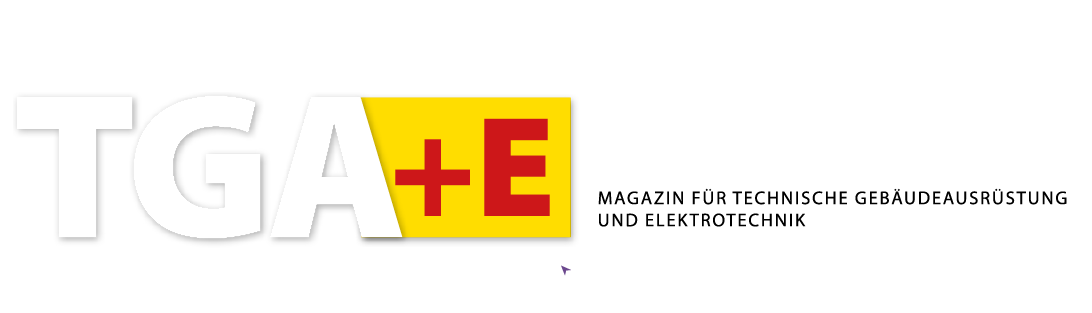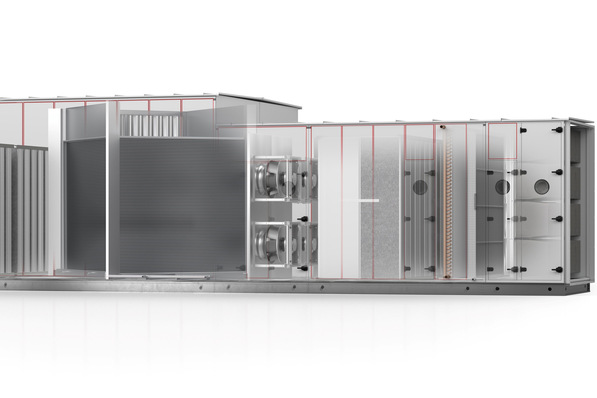calla – stock.adobe.com
Die öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland hat 2024 einen Rekordanteil erneuerbarer Energien von 62,7 % erreicht und der Strommix war so CO2-arm wie nie zuvor. Das geht aus einer Auswertung hervor, die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE schon am 2. Januar 2025 vorgelegt hat. Quelle der Daten ist die Plattform energy-charts.info
Der Artikel kompakt zusammengefasst
■ Die öffentliche Nettostromerzeugung in Deutschland hatte 2024 einen Anteil erneuerbarer Energien von 62,7 %. Bei der Solarstrom-Erzeugung wurde ein neuer Bestwert von 72,2 TWh erzielt.
■ 2024 betrug die Last im Stromnetz 462 TWh, rund 4 TWh mehr als im Vorjahr.
■ Die Last beinhaltet den Stromverbrauch aus dem Netz und die Netzverluste, aber nicht den Pumpstromverbrauch, den Eigenverbrauch der konventionellen Kraftwerke und den Eigenverbrauch bei Solaranlagen. Die Last wurde durch den Selbstverbrauch von Solarstrom um rund 12,4 TWh verringert.
Wenngleich sie im Bundestagswahlkampf teilweise skurril instrumentalisiert wurde, war Windkraft im Jahr 2024 erneut die wichtigste Stromquelle in Deutschland, sie trug 136,4 TWh (Mrd. kWh) bzw. 33 % zur öffentlichen Stromerzeugung bei. 2024 war jedoch ein schwächeres Windjahr als 2023 (139 TWh). Der Beitrag der Onshore-Windkraft sank auf 110,7 TWh (2023: 115,9 TWh), die Offshore-Produktion lag mit 25,7 TWh etwas über dem Vorjahresniveau (2023: 23,5 TWh). Der Ausbau der Windenergie ist weiterhin deutlich hinter dem Plan zurück: Bis November 2024 waren onshore 2,4 GW neu errichtet, geplant waren 7 GW. Der Ausbau der Offshore-Anlagen verlief etwas besser als in den Vorjahren. 2024 wurden offshore 0,7 GW neu errichtet – geplant sind 5 bis 7 GW jährlich bis 2026 und insgesamt 30 GW bis 2030.
Photovoltaik-Anlagen haben im Jahr 2024 ca. 72,2 TWh erzeugt, wovon 59,8 TWh ins öffentliche Netz eingespeist und 12,4 TWh im Eigenverbrauch genutzt wurden. Die gesamte Produktion hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 10,8 TWh bzw. 18 % erhöht. Der Photovoltaik-Anteil an der öffentlichen Nettostromerzeugung lag bei 14 %. Der Juli 2024 war mit 10,3 TWh der Monat mit der höchsten solaren Stromerzeugung. Der Photovoltaik-Ausbau übertraf im Jahr 2024 wie bereits 2023 die Ziele der Bundesregierung: Statt der geplanten 13 GW wurden bereits bis November 13,3 GW errichtet. Wenn alle Daten für 2024 vorliegen, werden es voraussichtlich für das Gesamtjahr 15,9 GW sein. Der PV-Zubau in Deutschland liegt damit weiterhin auf einem zweistelligen Niveau.
Wasserkraft lag mit 21,7 TWh etwa auf dem Niveau des Vorjahres (19,1 TWh). Die installierte Leistung von Laufwasseranlagen liegt bei 6,4 GW. Biomasse trug 36 TWh zur Stromerzeugung bei, wobei 2024 die installierte Leistung unverändert bei 9,1 GW lag.

Fraunhofer ISE / energy-charts.info
Erneuerbare legen absolut und auch relativ zu
Insgesamt produzierten die erneuerbaren Energien im Jahr 2024 ca. 275,2 TWh Strom und liegen damit 4,4 % über dem Vorjahr (267 TWh). Der Anteil des in Deutschland mit erneuerbaren Energien erzeugten Stroms an der Last, d. h. dem Strommix, der tatsächlich aus der Steckdose kommt, lag bei 56 % gegenüber 55,3 % im Jahr 2023.
Die gesamte Nettostromerzeugung beinhaltet neben der öffentlichen Nettostromerzeugung auch die Eigenerzeugung von Industrie und Gewerbe, die hauptsächlich mit Gas erfolgt. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Nettostromerzeugung einschließlich der Kraftwerke der „Betriebe im verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden“ liegt 2024 bei ca. 58,6 % (2023: 54,7 %).
CO2-Emissionen deutlich gesunken
Durch den steigenden Anteil erneuerbarer Energien und den Rückgang der Kohleverstromung war 2024 die Stromerzeugung so CO2-arm wie nie zuvor j, seit 2014 haben sich die Emissionen aus der Stromerzeugung halbiert (von 312 auf ca. 152 Mio. tCO2/a). 2024 lagen die CO2-Emissionen der deutschen Stromerzeugung 58 % niedriger als zu Beginn der Datenerhebung 1990.
2024 betrug die Last im Stromnetz 462 TWh und liegt damit leicht über dem Niveau des Jahres 2023 von 458 TWh. Dabei ist zu beachten, dass der Eigenverbrauch von Solarstrom auf ca. 12,4 TWh gestiegen ist. Dieser Eigenstromverbrauch zählt gemäß Definition nicht zur Last, deutet aber auf einen insgesamt gewachsenen Stromverbrauch hin. Die Last umfasst den Stromverbrauch aus dem Netz und die Netzverluste, aber nicht den Pumpstromverbrauch und den Eigenverbrauch der konventionellen Kraftwerke.
Batteriespeicherkapazität entwickelt sich rasant
Parallel zum Ausbau der erneuerbaren Energiequellen in Deutschland steigt auch der Bedarf an Speicherkapazität. Dezentrale Batteriespeicher sind besonders gut geeignet, um die Erzeugung von Wind- und Solarstrom zu puffern. So werden neue Photovoltaik-Anlagen in Privathaushalten meistens gemeinsam mit einem Heimspeicher installiert. Noch fehlen allerdings bei den meisten kleinen Anlagen die Eingriffsmöglichkeiten oder Anreizsysteme für einen netzdienlichen Betrieb. Im Segment der Großspeicher könnte sich in den nächsten Jahren die installierte Leistung vervielfachen, wenn alle von Projektierern im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur vorangemeldeten Projekte umgesetzt werden.
Die installierte Batterieleistung stieg 2024 stark auf 12,1 GW (8,6 GW in 2023), die Speicherkapazität stieg von 12,7 GWh auf 17,7 GWh. Die Leistung der deutschen Pumpspeicherwerke liegt bei rund 10 GW.
Kohleverstromung weiter rückläufig
2024 war in Deutschland das erste volle Jahr ohne nationale Stromerzeugung aus Kernkraft seit 1962, nachdem im April 2023 die letzten drei Kernkraftwerke Emsland A, Neckarwestheim 2 und Isar 2 abgeschaltet wurden. In ihrem letzten Betriebsjahr hatten sie 6,3 % der öffentlichen Stromerzeugung geliefert. Dies wurde durch die Erzeugung aus erneuerbaren Energien energetisch ersetzt.
2024 ging auch die öffentliche Nettostromerzeugung der deutschen Kohlekraftwerke weiter zurück: Braunkohle lieferte 71,1 TWh, das sind 8,4 % weniger als im Vorjahr (77,6 TWh). Hinzu kamen 1,3 TWh für den industriellen Eigenverbrauch. Noch stärker sank die Nettoproduktion aus Steinkohlekraftwerken: Sie lieferten 24,2 TWh, ein Minus von 27,6 % gegenüber 2023 (33,4 TWh), für den industriellen Eigenverbrauch wurde kein Steinkohlestrom mehr genutzt.

Fraunhofer ISE / energy-charts.info
Für historische Vergleiche muss die Bruttostromerzeugung betrachtet werden, da es erst seit 2002 Zahlen zur Nettostromerzeugung gibt. Die Bruttostromerzeugung aus Braun- und Steinkohle in Summe wird für 2024 ungefähr bei 108 TWh liegen. Ein so niedriges Niveau gab es in Deutschland zuletzt im Jahr 1957.
Die Nutzung von Erdgas zur Stromerzeugung stieg 2024 mit 48,4 TWh für die öffentliche Stromversorgung um 9,5 % über das Niveau des Vorjahres. Erdgas trug zudem 25,6 TWh zur industriellen Eigenversorgung bei.
Zur Datengrundlage
Die erste Version der Jahresauswertung 2024 vom 01.01.2024 berücksichtigt alle Stromerzeugungsdaten der Leipziger Strombörse EEX bis einschließlich 31.12.2024. Über die verfügbaren Monatsdaten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zur Elektrizitätserzeugung bis einschließlich September 2024 und die Monatsdaten zur Ein- und Ausfuhr von Elektrizität bis einschließlich Oktober 2024 wurden die Viertelstundenwerte von EEX und Entso-E energetisch korrigiert. Für die restlichen Monate wurden die Korrekturfaktoren auf Basis von zurückliegenden Jahresdaten abgeschätzt. Die hochgerechneten Werte unterliegen größeren Toleranzen.
Zugrunde liegen die Daten zur deutschen Nettostromerzeugung zur öffentlichen Stromversorgung. Sie ist die Differenz zwischen Bruttostromerzeugung und Eigenverbrauch der Kraftwerke und wird in das öffentliche Netz eingespeist. Die Stromwirtschaft rechnet mit Nettogrößen, z. B. für den Stromhandel und die Netzauslastung, und an den Strombörsen wird ausschließlich die Nettostromerzeugung gehandelt. Sie repräsentiert den Strommix, der tatsächlich zu Hause aus der Steckdose kommt. Quelle: Fraunhofer ISE
Export und Börsenstrompreis
2023 verzeichnete Deutschland erstmals einen Importüberschuss von 9,2 TWh, was besonders an den geringeren Stromerzeugungskosten in den europäischen Nachbarländern im Sommer und den hohen Kosten der CO2-Zertifikate lag. Der Import stieg 2024 insbesondere wegen der niedrigen Strompreise der Nachbarländer im Sommer im Saldo auf 24,9 TWh. Die wichtigsten Importländer waren Frankreich (Saldo 12,9 TWh), Dänemark (12,0 TWh), Schweiz (7,1 TWh) und Norwegen (5,8 TWh). Deutschland exportierte Strom im Saldo nach Österreich (7,4 TWh), Polen (3,5 TWh), Luxemburg (3,5 TWh) und Tschechien (2,8 TWh).
Im November und Dezember 2024 sind die Börsenstrompreise deutlich gestiegen. Dadurch wurde die fossile Stromerzeugung zeitweise rentabler als im Sommer, und die Importe fielen in der Folge. Deutschland hat im Gegensatz zu seinen Nachbarländern (Österreich, Schweiz, Frankreich) auch im Winter genügend Kraftwerkskapazitäten, um Strom für den Export zu produzieren.
Der durchschnittliche volumengewichtete Day-Ahead Börsenstrompreis ging 2024 um 15,5 % zurück auf 78,01 Euro/MWh bzw. 7,8 Ct/kWh (2023: 92,29 Euro/MWh). Er liegt damit auch unter dem Niveau des Jahres 2021 (93,36 Euro/MWh). Im Jahr 2022 lag der Börsenstrompreis bei 230,57 Euro/MWh bedingt durch den Angriff auf die Ukraine und die damit ausgelöste Energiekrise und durch die Nichtverfügbarkeit vieler Kernkraftwerke in Frankreich.
Eine ausführliche Präsentation der Daten zu Stromerzeugung, Import/Export, Preisen, installierten Leistungen, Emissionen und Klimadaten finden sich auf dem Energy-Charts Server: www.energy-charts.info
Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Energieträger
Auch ohne Grundlastkraftwerke ist die Stromversorgung gesichert
Ein Grundlastkraftwerk kann kontinuierlich Strom liefern, muss wegen seiner hohen Investitionskosten allerdings auch fast durchgehend in Betrieb sein, um sich zu rentieren. Wird diese Art Kraftwerk im zukünftigen Energiesystem noch nötig sein, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten? Fachleute von „Energiesysteme der Zukunft“ (ESYS) – einer gemeinsamen Initiative von acatech, Leopoldina und Akademienunion – haben diese Frage anhand von Modellierungen untersucht. Der Impuls „Kernspaltung, Erdgas, Geothermie, Kernfusion: Welche Rolle spielen Grundlastkraftwerke in Zukunft?“ zeigt: Für eine sichere Stromversorgung braucht es Grundlastkraftwerke nicht unbedingt. Sie könnten aber auch zukünftig eine Rolle spielen, falls sie wettbewerbsfähig sind.
Für eine klimafreundliche und zuverlässige Stromversorgung wird in jedem Fall eine Kombination aus Solar- und Windenergieanlagen mit Speichern, einem flexiblen Wasserstoffsystem, einer flexiblen Stromnutzung und Residuallastkraftwerken nötig sein. Letztere sind Kraftwerke, die nur bei Bedarf zeitweise laufen, zum Beispiel mit Wasserstoff betriebene Gasturbinenkraftwerke. In dieses System könnten Grundlastkraftwerke integriert werden. Ihre größte Auswirkung auf das Gesamtsystem: Sie könnten mit ihren Stromüberschüssen Elektrolyseure mit Strom versorgen und so Wasserstoffimporte verringern. Auch ohne Grundlastkraftwerke wäre die Versorgungssicherheit jedoch gewährleistet.
Bei ihren Untersuchungen haben sich die ESYS-Fachleute auf vier Technologien konzentriert: Kernkraftwerke, Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke für Erdgas mit anschließender CO2-Abscheidung, Geothermie zur Stromerzeugung und Kernfusionskraftwerke. In den nächsten 20 Jahren in großem Umfang realisierbar sind wahrscheinlich am ehesten die Gaskraftwerke. Die Herausforderungen dabei: Die Infrastruktur für das abgeschiedene Kohlenstoffdioxid muss erst noch aufgebaut, eine parallele Gas- und Wasserstoffinfrastruktur muss betrieben und Restemissionen aus der Gasförderung und dem Kraftwerksbetrieb müssen zusätzlich ausgeglichen werden.
Ausgehend von den bisherigen Kostenentwicklungen der verschiedenen Technologien erwarten die ESYS-Fachleute nicht, dass Grundlastkraftwerke die Gesamtkosten der Energieversorgung senken würden. „Damit Grundlastkraftwerke zu einer substanziellen Kostensenkung führen, müssten ihre Kosten erheblich unter das heute prognostizierte Niveau fallen“, betont Karen Pittel, Leiterin des ifo-Instituts und stellvertretende Vorsitzende des ESYS-Direktoriums. „Tatsächlich schätzen wir Risiken für Kostensteigerungen und Verzögerungen bei Grundlasttechnologien tendenziell sogar höher ein als beim weiteren Ausbau der Solar- und Windenergie.“ www.energiesysteme-zukunft.de