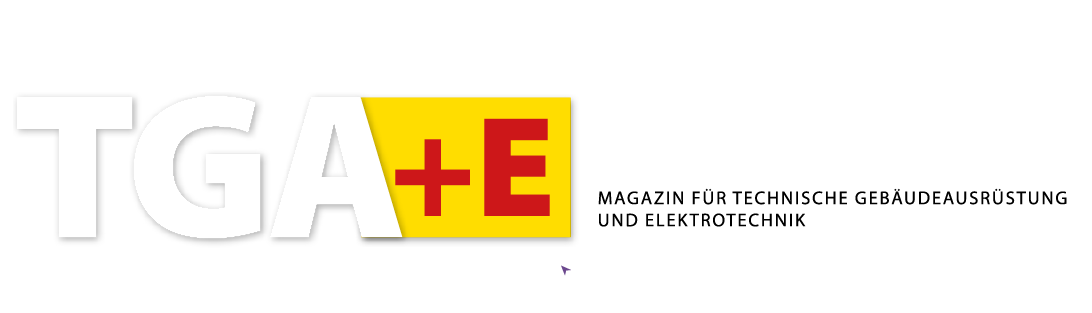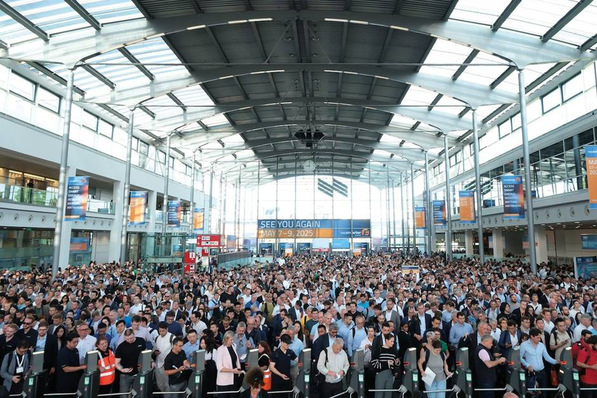Phoenix Contact
Der Energieverbrauch zur Temperierung von Gebäuden wird von Jahr zu Jahr durch unterschiedliche klimatische Bedingungen beeinflusst. Wie können Energiemanager den Faktor „Wetter“ einberechnen und eine Vergleichbarkeit der Werte über einen längeren Zeitraum sicherstellen? Die Lösung lautet Witterungsbereinigung – und diese lässt sich mit digitaler Unterstützung schnell umsetzen.
Der Artikel kompakt zusammengefasst
■ Über standortspezifische Heiz- und Kühlgradtage lassen sich gemessene Energieverbräuche von Witterungseinflüssen bereinigen.
■ Nur mit bereinigten Energieverbräuchen ergeben sich aussagekräftige Kennzahlen zur Überwachung und Analyse der Energieeffizienz von Wärme- und Kältesystemen. Dies gilt auch für Prognosen im Vorfeld von Optimierungsmaßnahmen.
Der Energieaufwand zum Heizen und Kühlen ist ein wesentlicher Faktor im Energiemanagement. Während die Erhebung der Verbräuche einfach implementiert werden kann, ist bei Auswertungen und Schlussfolgerungen Vorsicht geboten: Das tägliche Wetter hat einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse. Sollen Verbräuche über längere Zeiträume, an verschiedenen Standorten oder nach einer energetischen Sanierung gegenübergestellt werden, braucht es eine Witterungsbereinigung. Als Grundlage dafür haben sich Heiz- und Kühlgradtage bewährt.

Phoenix Contact
Heizgradtage (HGT) quantifizieren den theoretisch benötigten Heizbedarf von Gebäuden und leiten sich aus der Außentemperatur ab. Diese wird dann mit einer Schwellwerttemperatur verglichen. Unterschreitet die gemessene Temperatur den Schwellwert, zählen die Dauer und Differenz der Unterschreitung als Annährung dafür, wie viel das Gebäude geheizt werden muss.
Die gewählte Schwelle variiert zwischen Ländern und Anwendungsfällen. In Deutschland und der EU wird für gewöhnlich eine Schwelle von 15,5 °C genutzt. Analog zu den Heizgradtagen werden Kühlgradtage (KGT) verwendet, um den erforderlichen Kühlbedarf von Gebäuden zu ermitteln. Diese Messung kommt hauptsächlich in heißeren Klimazonen zum Einsatz, gewinnt aber aufgrund steigender Temperaturen auch in kühleren Klimazonen an Bedeutung. Da in Deutschland nur eine niedrige Zahl an Kühlgradtagen pro Jahr anfällt, eignen sich Kühlgradstunden ebenfalls als Messgröße.
Berechnung der Gradtagzahlen
Zeitreihendaten für Heiz- und Kühlgradtage erhalten Energiemanager, indem sie die Daten für ihre Standorte beispielsweise als csv-Datei von der Webseite des Deutschen Wetterdienstes herunterladen. Zur eigenen Berechnung der Gradtagzahlen lassen sich unterschiedliche Methoden nutzen, die sich in der Auflösung und in puncto Rechenaufwand differenzieren.
Die einfachste Methode verwendet die tägliche Durchschnittstemperatur. Für diese wird geprüft, ob sie über oder unter dem Schwellwert liegt und dementsprechend die Gradzahl für diesen Tag errechnet.

Eine Variation dieser Methode zieht das Mittel aus Höchst- und Tiefsttemperatur eines Tags als Durchschnittstemperatur heran. Durch die Mittelung über einen Tag fallen kürzere Überschreitungen des Schwellwerts weniger ins Gewicht.
Wird der Energieverbrauch zu stark von kurzen Temperaturänderungen beeinflusst, lässt sich die temporale Auflösung der Berechnung weiter erhöhen: Statt der Tagesdurchschnittstemperatur kommt dann die stündliche Temperatur zum Zug. Diese wird analog mit dem Schwellwert verglichen. So werden die „Gradstunden“ ermittelt, die anschließend in Gradtage umrechenbar sind.

Phoenix Contact
Gerade bei einer digitalen Aufzeichnung der Außentemperaturen können Energiemanager die Auflösung der Gradtagzahlen sowie der Rohdaten steigern. Für jeden Messpunkt wird die Gradtagzahl durch den Abstand zum nächsten Messpunkt normalisiert. Dieses Vorgehen kommt dem Integral über die positive Differenz zum Schwellwert gleich.
Berücksichtigung des Wetters als Variable
Um den effizienten Einsatz von Energie bewertbar zu machen, nutzt das Energiemanagement Energie-Performance-Indikatoren (EnPIs) als zentrale Kennzahlen. Eine valide Analyse bezieht dabei möglichst alle Faktoren, die Auswirkungen auf den Gesamtenergieverbrauch haben, als relevante Variable in die EnPIs ein.
Beispiel: Bei einer Fertigungslinie wird nicht der Gesamtenergieverbrauch als EnPI verwendet, sondern beispielsweise der Energieverbrauch pro produzierte Einheit, weil die Auslastung der Anlage einen großen Einfluss auf den Verbrauch hat. Bei der Beurteilung und zum Vergleich des Heizenergieverbrauchs in Gebäuden gleicher Art und Nutzung, der Optimierung von Energiesparmaßnahmen und zur Minimierung des Heizenergieverbrauchs müssen Energiemanager also das Wetter als Variable berücksichtigen und herausrechnen können.
Beispiel: Sanierungsmaßnahmen und unterschiedliche Standorte
Als Beispiel sei ein Gebäude herangezogen, das ein Unternehmen kürzlich durch verschiedene Maßnahmen saniert hat, was unter anderem die Heizeffizienz verbessern sollte. Nach einem Jahr sind die Maßnahmen zu bewerten. In diesem Zusammenhang wird festgestellt, dass das Gebäude vor der Sanierung einen Heizenergieverbrauch von 100 MWh hatte, der Wert jetzt jedoch bei 120 MWh liegt. Dient der höhere Jahresverbrauch als Messgrundlage, müsste die energetische Sanierung als gescheitert eingestuft werden.

Phoenix Contact
Verwendet der Betreiber allerdings eine Witterungsbereinigung und bezieht die Heizgradtage mit ein, leitet sich ein anderes Bild ab: Das Jahr vor den Maßnahmen hatte 1000 HGT, das Jahr danach 1500 HGT. Ein Vergleich der Jahre mit dem EnPI „Verbrauch / HGT“ ergibt einen Wert von 100 kWh/HGT vor der Sanierung und von 80 kWh/HGT nach der Maßnahme. Erst die Witterungsbereinigung verdeutlicht somit, dass ein ungewöhnlich kalter Winter den gestiegenen Gesamtverbrauch verursacht hat. Die Sanierungsmaßnahmen haben tatsächlich die Heizkosten gesenkt. Anmerkung: Im Beispiel wurde die Maßnahme über den EnPI „rehabilitiert“. Es ist jedoch genauso wichtig, nur scheinbar erfolgreiche Maßnahmen als solche zu „entlarven“, um frühzeitig den Ursachen für Zielabweichungen nachzugehen. Denn ein unnötig hoher Energieverbrauch lässt sich nur für die Zukunft, aber nicht mehr nachträglich korrigieren.
Ein weiterer Anwendungsfall ist die Gegenüberstellung von Standorten. Da an weit voneinander entfernten Standorten unterschiedliche Wetterbedingungen herrschen, lassen sich die Gesamtverbräuche auch hier nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Als Beispiel seien Gebäude A und B genannt, die sich an verschiedenen Standorten befinden.
Weil die Gebäude unterschiedliche Größen haben, wird der Gesamtverbrauch zuerst durch die Fläche normalisiert. Gebäude A hat im gemessenen Jahr einen Verbrauch von 50 kWh/m2 und Gebäude B von 60 kWh/m2. Aufgrund dieser Daten scheint Gebäude A deutlich effizienter zu sein. Über die Witterungsbereinigung wird jedoch aufgedeckt, dass es 1000 HGT am Standort des Gebäudes A gab, in der Umgebung von Gebäude B aber 1200 HGT. Werden diese HGT in die Vergleichswerte integriert, ergibt sich der EnPI „Verbrauch / (Fläche × HGT)“. Dieser beträgt 0,05 kWh/(m2 ∙ HGT). Folglich weisen beide Gebäude eine ähnliche Heizeffizienz auf.
Vereinfachung durch digitale Tools
Durch die Einbeziehung von Heiz- und Kühlgradtagen lassen sich Energieverbräuche von Witterungseinflüssen bereinigen. Erst dann resultieren aus der Überwachung und Analyse der Energieeffizienz von Wärme- und Kältesystemen valide Zahlen – und der Betreiber kann die Maßnahmen zur Verbesserung des Energieeinsatzes verlässlich bewerten.

Phoenix Contact
Besonders einfach gestalten sich das Monitoring und die Schlussfolgerungen mit digitalen Tools, beispielsweise dem Energy Management Service der IIoT-Plattform Proficloud.io. Der Smart Service ist auf die Bedürfnisse von Energiemanagern zugeschnitten und bietet wichtige Funktionen zum Verständnis von Energiedaten:
● optimiertes Energiemanagement mit Blick auf die internationale Norm ISO 50001
● Witterungsbereinigung als Funktion; in Planung ist zudem ein automatischer Import von Wetterdaten
● hohe Benutzerfreundlichkeit sowie intuitive Menüführung
● Visualisierungsmöglichkeiten und leicht verständliche Dashboards
● verbesserte Arbeitsabläufe sowie die Steigerung von Effizienzen durch eine orts- und zeitunabhängige Überwachung von Energie- und Leistungsdaten
● automatisierte Datenübertragung an die IIoT-Plattform Proficloud.io bei der Nutzung IIoT-fähiger Hardware, etwa über die Schnittstellen der Energiemessgeräte EMpro, Steuerungen PLCnext Control und des grafischen Entwicklungswerkzeugs NodeRed
Der skalierbare Service ist vielfältig und branchenübergreifend verwendbar. Er eignet sich insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, da er ohne eigene IT-Ressourcen direkt einsetzbar ist.
Skalierbare SaaS-Lösungen
Bei der Phoenix Contact Smart Business GmbH handelt es sich um das Kompetenzzentrum von Phoenix Contact für industrielle Cloud-basierte Smart Services und Data Analytics. Ein wachsendes Team in Bad Pyrmont und Berlin entwickelt standardisierte und skalierbare Software-as-a-Service(Saas)-Lösungen – die sogenannten Smart Services. Aktuell verfügbar sind unter anderem:
● Energy Management Service
● Impulse Analytics Service
● Time Series Data Service
● Charge Repay Service
● Device und User Management Service
Damit können Unternehmen die Vorteile der Digitalisierung und des Industrial IoT ausschöpfen. www.proficloud.io/smart-services
Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Energiemanagement