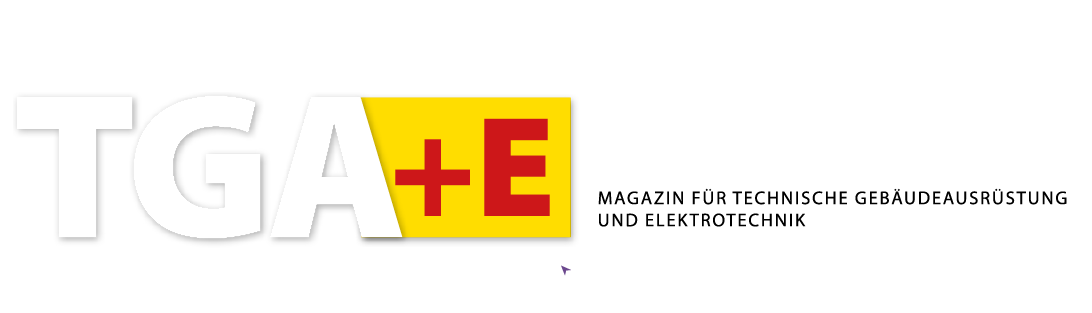Francesco Scatena – stock.adobe.com
Seit dem Jahr 2023 stehen sogenannte PFAS verstärkt im Licht der Öffentlichkeit. Bedingt durch Berichte in überregionalen Tageszeitungen wurden die sogenannten ewigen Chemikalien allgemein bekannt. Und immer wieder werden sie auch in Verbindung mit den gängigen Kältemitteln der Branche genannt. Haben PFAS das Potenzial, zusätzlich zu den neuen Regeln der F-Gase-Verordnung für weitere Verbote und Regeln in der Kälte- und Klimabranche zu sorgen?
Der Artikel kompakt zusammengefasst
■ Eine dreiteilige Artikelserie liefert Daten und Fakten zur Novelle der F-Gase-Verordnung, Fragen zum Umgang mit der Novelle aus der Praxis und hier nun Informationen zur Diskussion über PFAS und mögliche Auswirkungen auf die Kälte-Klima-Wärmepumpen-Branche.
■ Auch wenn das Thema PFAS noch lange nicht abgeschlossen ist, existiert in den meisten im TGA-Segment relevanten Kälte-Klima-Wärmepumpen-Anwendungen Planungssicherheit, auch langfristig für Wartung und Service.
■ Es zeigt sich, dass der Branche zwar Änderungen bevorstehen, sich diese aber durch den Einsatz bereits bekannter Kältemittel in vielen Fällen bewältigen lassen und der Wettbewerb dazu beitragen wird, dass zu jedem Zeitpunkt die notwendige Anlagentechnik bereitstehen wird.
.
Die Abkürzung PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, eine Gruppe von Chemikalien, die seit den 1940er-Jahren entwickelt wurden. Sie werden (bzw. wurden) aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften wie Hitzebeständigkeit, Wasser- und Fettabweisung sowie chemischer Persistenz in einer Vielzahl von Produkten aus allen Bereichen eingesetzt, darunter Teflonbeschichtungen, wasserabweisende Textilien, Feuerlöschschaum und Lebensmittelverpackungen, im Maschinenbau, der Automobilindustrie und elektronischen Produkten sowie der Medizintechnik. Bei diesen organischen Verbindungen sind die Wasserstoffatome vollständig (perfluoriert) oder teilweise (polyfluoriert) durch Fluoratome ersetzt worden.

jorisvo – stock.adobe.com
In den letzten Jahrzehnten wurde bekannt, dass PFAS eine potenzielle Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen können. Studien haben gezeigt, dass sie sich in der Umwelt nicht abbauen und sich in Organismen anreichern können. Einige PFAS-Verbindungen wurden mit Gesundheitsproblemen wie Krebs, hormonellen Störungen und Beeinträchtigungen des Immunsystems in Verbindung gebracht. Ein Beleg für diesen Verdacht wurde bislang noch nicht erbracht und ist Gegenstand mehrerer wissenschaftlicher Untersuchungen. Allerdings wurden in den letzten Jahren bei bestimmten PFAS neben Wirkungen in der Umwelt auch gesundheitsschädliche Wirkungen nachgewiesen.
Aufgrund dieser Bedenken haben viele Länder aber bereits begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Einsatz von PFAS zu reduzieren. Einige haben bestimmte PFAS-Verbindungen verboten oder ihre Verwendung stark eingeschränkt. Es wurden auch Richtlinien für sichere Trinkwasserstandards und Grenzwerte für PFAS in Lebensmitteln festgelegt. Ein generelles Verbot der gesamten PFAS-Stoffgruppe hätte jedoch umfangreiche Auswirkungen auf den Maschinenbau und damit auch auf die Kälte- und Wärmepumpentechnik.
Die aktuelle Entwicklung konzentriert sich auf die Erforschung von Alternativen zu PFAS und die Implementierung von Methoden zur Reinigung von PFAS-belasteten Umweltbereichen. Es gibt Bemühungen, umweltfreundlichere Beschichtungen und Textilien zu entwickeln, die die gleichen Eigenschaften wie PFAS aufweisen, aber weniger schädlich sind. Darüber hinaus wird an Technologien zur Entfernung von PFAS aus Wasser und Böden gearbeitet. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die Forschung zu PFAS noch im Gange ist und neue Erkenntnisse gewonnen werden.
Welche Substanzen sind PFAS?
Welche Bedingungen (Definitionen) muss eine Chemikalie erfüllen, um als PFAS zu gelten? Sie muss mobil, persistent und bioakkumulativ sein. Mobil bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Chemikalie sich als Substanz innerhalb der Atmosphäre bewegen kann und nicht fest an einen Stoff oder ein Material gebunden ist. Persistent heißt, dass sich die Chemikalie in der Umwelt nicht weiter zersetzt oder abbaut, sondern in ihrer Form bestehen bleibt. Deswegen werden PFAS auch als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet.
Bioakkumulativ ist eine Chemikalie dann, wenn sie sich z. B. in der Atmosphäre befindet, durch Regen ausgewaschen wird und dadurch in die Flüsse und die Umwelt gelangt. Über die Nahrungskette kommen die Chemikalien dann in den Menschen. Dass PFAS mobil und persistent sind, ist mittlerweile belegt. Das Merkmal „bioakkumulativ“ wird aktuell noch untersucht.

hecke71 – stock.adobe.com
Regulierungen zu PFAS sind Teil des EU-Chemikalienrechts
Und was haben PFAS genau mit Kältemitteln und der Branche zu tun? Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass die F-Gase-Verordnung ein Teil des Klimaschutzprogramms der Europäischen Union (EU) ist. Regulierungen zu PFAS sind Teil des EU-Chemikalienrechts. Hierbei geht es um alle Chemikalien, die in Prozessen verwendet werden und EU-Bürger in irgendeiner Form betreffen können.
PFAS sind in diesem Zusammenhang eine Produktgruppe aus der Fluorchemie, die mehr als 10 000 unterschiedliche Substanzen enthält. Diese Substanzen sind aufgrund ihrer chemischen Struktur durch die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) als PFAS definiert. Einen Einfluss auf das Klima oder CO2-Emissionen durch PFAS werden im EU-Chemikalienrecht nicht reguliert.
Kältemittel selber gehören zur Gruppe der fluorierten Gase. Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, die derzeit hauptsächlich in Form verschiedener Kältemittel genutzt werden, zersetzen sich in der Atmosphäre durch fotochemische Reaktionen in verschiedene Substanzen. Ein Teil dieser Substanzen ist die Trifluoressigsäure (TFA, das perfluorierte Derivat der Essigsäure). Und diese Trifluoressigsäure fällt wiederum unter die PFAS-Definition der OECD. Nicht das Kältemittel an sich, sondern deren Abbauprodukte in der Atmosphäre erfüllen damit die Definition eines PFAS.
Weitere Substanzen die unter die PFAS-Definition fallen, sind zum Beispiel Fluorpolymere die in Fluorelastomeren, Kunststoffen und Ölen im Maschinenbau essentiell sind. Aber auch Anwendungen in Kälte-, Klima-, Wärmepumpen- und Lüftungsanalagen sowie Konstruktions- und Beschichtungswerkstoffe für Bauteile, Dichtungsmaterialien in Dichtungssystemen aller Art, elektrotechnische- und elektronische Komponenten gehören dazu.
TFA hat auch natürlichen Ursprung

Mitsubishi Electric
Trifluoressigsäure (TFA) kann neben dem künstlichen auch einen natürlichen Ursprung haben – nämlich hydrothermale Schlote und Vulkanismus. Bei Vulkanausbrüchen wird Trifluoressigsäure weit in die Atmosphäre geschleudert und gelangt so u. a. auch in die Weltmeere, die die Chemikalie wiederum auf das Land eintragen. Möglich ist auch eine natürliche (geogene) Entstehung von TFA bei der Verwitterung von Gesteinsarten wie Granit oder Fluorit.
Welchen Anteil natürliche und künstliche Quellen an der Emission von Trifluoressigsäure in die Atmosphäre haben, ist noch nicht geklärt und ist aktuell ebenfalls Thema mehrerer wissenschaftlicher Untersuchungen. Belegt ist, dass TFA durch menschliches Handeln (anthropogen) in die Umwelt gelangt, in Deutschland gehören Pestizide sowie Kälte- und Treibmittel zu den maßgeblichen Quellen.
Beschränkungsvorschlag
Bereits 2019 wurde die EU-Kommission durch den EU-Ministerrat dazu aufgefordert, einen Aktionsplan zu entwickeln, um alle nicht wesentlichen Verwendungen von PFAS zu unterbinden. Auf der Basis einer Initiative der Niederlande und unter der Co-Leitung von Deutschland wurde gemeinsam mit Dänemark, Norwegen und Schweden Anfang 2023 ein Beschränkungsvorschlag eingereicht, um ein Verbot zur Herstellung und Verwendung von PFAS zu erreichen. Im Februar 2023 wurde dieser Beschränkungsvorschlag durch die Europäische Chemikalienagentur veröffentlicht. Dieser Vorschlag konnte im Herbst 2023 im öffentlichen Verfahren durch EU-Bürger, Unternehmen und Institutionen kommentiert werden.
Insgesamt wurde eine große Zahl von Kommentaren zu den betroffenen Substanzen und deren Anwendung bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) eingereicht. Im weiteren Verfahren prüfen die Kommissionen zur Risikobewertung der Chemikalien (RAC) und sozioökonomischen Auswirkung von Verboten (SEAC) innerhalb der ECHA die Kommentare und die vermeintliche Regulierung der betroffenen Substanzen. Am Ende wird ein Bericht zum Beschränkungsvorschlag erstellt und an die EU-Kommission übermittelt, die dann wiederum einen endgültigen Gesetzesvorschlag unterbreitet und diesen den EU-Mitgliedstaaten zur Diskussion und Entscheidung vorlegen wird.
Generelles PFAS-Verbot ist abwegig

Mitsubishi Electric
„Würde es dazu kommen, dass die rund 10 000 Substanzen, die PFAS direkt enthalten oder über ihre Abbauprodukten freisetzen können, in wenigen Jahren verboten werden würden, beträfe das nicht nur die Heizungs-, Klima- und Kältebranche sondern nahezu jeden industriellen Prozess in der gesamten EU“, so Michael Lechte, Manager Produktmarketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Es könnten weder Autos, noch Smartphones, Flugzeug- und Windturbinen, Solarkollektoren oder viele medizinische Produkte mehr hergestellt werden. Deswegen wird nun sehr genau geprüft, wo PFAS notwendig sind und es keine technischen Alternativen gibt.“
Vor welcher Mammutaufgabe die EU-Kommission damit steht, zeigen die rund 5600 Rückmeldungen auf den Beschränkungsvorschlag, die von Bürgern, Unternehmen und Institutionen eingegangen sind. Hier werden u. a. die sozioökonomischen Auswirkungen geprüft, wenn PFAS in bestimmten Anwendungen oder Prozessen nicht mehr eingesetzt werden dürfen.
2025 soll dann ein Gesetzesvorschlag durch die EU erstellt werden, nachdem alle Studien abgeschlossen worden sind. Es zeichnet sich bereits ab, dass dieser Zeitpunkt sehr wahrscheinlich nicht eingehalten werden kann, da sich der ganze Prozess aufgrund seiner Komplexität verzögert. Mit welchen Beschränkungen dann zu rechnen ist, lässt sich heute noch nicht konkret abschätzen. Auch der Zeitraum in dem dann Verbote und Ausnahmeregelungen greifen, ist noch nicht absehbar.
Bei Kältemitteln gibt es für viele Anwendungen schon Alternativen
Wie wäre die TGA-Branche dann von einem möglichen PFAS-Verbot betroffen? Lechte: „Mit den Kältemitteln, die hinsichtlich den neuen Regeln der F-Gase-Verordnung künftig vorrangig eingesetzt werden, steht die Branche in vielen Anwendungen auf der sicheren Seite. Denn sowohl R32 als auch R290 (Propan) fallen nicht unter die PFAS-Definition. Betroffen wären dagegen Kältemittel wie R134a, R410A, R407C und auch ungesättigte teilfluorierte Stoffe (HFO) wie R1234yf oder R1234ze.

U. J. Alexander – stock.adobe.com
Dass aber ein vollständiges PFAS-Verbot kommen wird, scheint kaum realistisch, denn dadurch würden letztendlich auch die Ziele der Energie- und Mobilitätswende untergraben. Die Klimaziele würden massiv in Gefahr geraten. Diese Position wird u. a. auch durch den Wirtschaftsminister Robert Habeck unterstützt. Auch an dieser Stelle sind die thematischen und sachlichen Verflechtungen zwischen PFAS-Verbot und F-Gase-Verordnung zu sehen, die durchaus vorhanden sind, aber letztendlich aus völlig unterschiedlichen Perspektiven andere Themen betreffen.
Nach den letzten Informationen plant die EU-Kommission deshalb PFAS als Gruppe generell einer Beschränkung zu unterziehen und dabei alle Anwendungen in nicht-essentielle, substituierbare und essentielle Produkte bzw. Verfahren einzuteilen. Konkrete Auswirkungen auf die Branche können und werden sich deshalb weder kurz- noch mittelfristig zeigen. Langfristig ist dagegen nicht nur innerhalb der Kälte-, Klima- und Heizungsbranche, sondern innerhalb nahezu jedes Produktionszweiges der Industrie mit neuen Vorschriften hinsichtlich der Verwendung von PFAS zu rechnen.
Fachberichte mit ähnlichen Themen bündelt das TGA+E-Dossier Regelwerk
Literatur
[1] Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014, Amtsblatt der Europäischen Union vom 20. Februar 2024, Serie L
[2] Schellhorn, Martin: F-Gase-Phase-down, Teil 1. Konsequenzen aus der neuen F-Gase-Verordnung – Fakten. Stuttgart: Gentner Verlag, TGA+E 04-2024
[3] Schellhorn, Martin: F-Gase-Phase-down, Teil 2. Konsequenzen aus der neuen F-Gase-Verordnung – FAQ. Stuttgart: Gentner Verlag, TGA+E 05-2024
Im Kontext:
Fragenkatalog zur novellierten F-Gase-Verordnung
Novellierte F-Gase-Verordnung tritt am 11. März 2024 in Kraft
Kältemittel: BDH begrüßt Trilog-Einigung zum F-Gase-Ausstieg
Natürliche Kältemittel auf der Überholspur