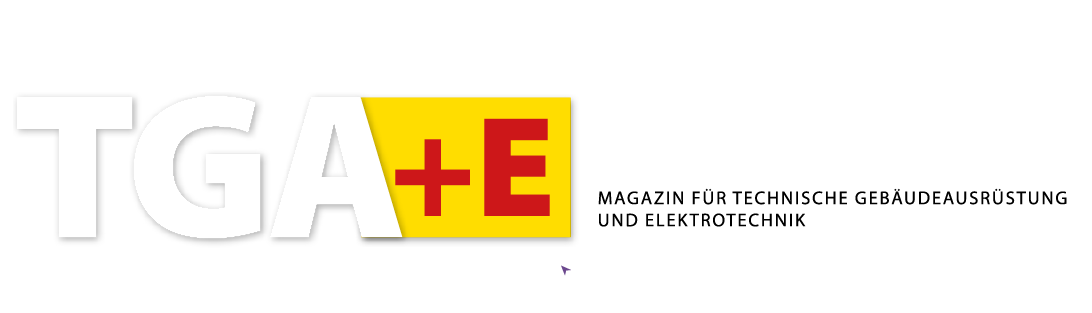K.-U. Häßler – stock.adobe.com
Die BEG-EM-Heizungsförderung bezuschusst u. a. den Umstieg auf Wärmepumpen. Je nach Standpunkt ist der Anreiz zu hoch oder zu niedrig. Beides stimmt …
Der Artikel kompakt zusammengefasst
■ Die Gesamtkosten eines Heizungssystems werden von zahlreichen Randbedingungen beeinflusst. Eine prozentuale Förderung auf Basis der Investitionskosten mit einer Bemessungsgrenze kann den tatsächlichen Förderbedarf nicht abbilden.
■ Die großen Unterschiede beim ermittelten Förderbedarf zeigen, dass die BEG EM im Rahmen der gewählten Parameter in wichtigen Fallgruppen parallel ungenügend, ausreichend und zu viel Zuschuss anbietet.
■ Wenn der Istzustand eine betagte Gas-Heizung ist, sind ihre laufenden Kosten kein geeigneter Vergleich für die Wirtschaftlichkeit. Der richtige Vergleich ist ein Heizsystem mit einer Restnutzungsdauer von mehr als 10 Jahren bzw. ein erneuertes Heizsystem.
Im (Nach)Wahlkampf, in der Branche, in Verbänden und der Öffentlichkeit wird schon ein Jahr nach dem Start der aktuell noch bei der KfW zu beantragenden BEG-EM-Heizungsförderung diskutiert. Teilweise abstrakt, teilweise mit sehr konkreten Vorschlägen. Mit einem ganz neuen Tenor: Die Förderung soll sinken, mitunter wird sogar eine schnelle Abschaffung gefordert. Eine bemerkenswerte Entwicklung. Denn Ende 2023, während der Entstehung des dann kurz vor dem Jahreswechsel 2023/24 veröffentlichten Förderprogramms, wurde insbesondere die auf 30 000 Euro halbierte (und nur noch einmalig zur Verfügung stehende) Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben für Anlagen zur Wärmeerzeugung teilweise scharf als viel zu niedrig kritisiert.
Zwei Punkte sind an der Diskussion irritierend:
Zum einen wird kaum benannt, dass die Heizungsförderung zwar an die auf EE-Heizsysteme umsteigenden Gebäudeeigentümer als nichtrückzahlbarer Zuschuss ausgeschüttet wird, sie durch die dadurch nicht mehr benötigten fossilen Brennstoffe aber ab 2027 auch die Nachfrage und damit den Preis für CO2-Zertifikate im ETS II reduziert. Sie entlastet also auch Haushalte, die noch mit fossilen Energieträgern beheizt werden. Die Wirkung entspricht genau dem im ETS II integrierten Mechanismus, Zertifikate früher zu versteigern, wenn durch eine zu hohe Nachfrage die Preise zu stark steigen.
Zum anderen wird kaum der tatsächliche Förderbedarf aufgezeigt, der von mehreren Parametern abhängt. Hierzu soll nachstehend eine Größenordnung des Förderbedarfs aufgezeigt werden. Variiert werden dafür
● der Nutzwärmebedarf in vier Stufen von 9000 bis 22 500 kWh/a
● der CO2-Preispfad mit 5 Steigungen
● die Jahresarbeitszahl (JAZ) der WP-Heizung in 5 Stufen
● der Jahresnutzungsgrad (JNG) der Gas-Heizung in 2 Stufen
● der Strompreis (indirekt)
Für zeitlich weitreichende Gesamtkostenbetrachtungen empfiehlt es sich grundsätzlich, von einem sinkenden Nutzwärmebedarf auszugehen. Auf diesen Einfluss wird hier verzichtet, da es nicht um konkrete Einzelfälle, sondern um die Bandbreite geht, mit der Hausbesitzer, Energieberater, Planer und Heizungsbauer sowie die Politik konfrontiert werden. Würde man einen sinkenden Nutzwärmebedarf im zeitlichen Verlauf berücksichtigen, würde sich die Gesamtkostendifferenz verringern und der Förderbedarf steigen.
Vergleichskonzept für den Förderbedarf
Das Vergleichskonzept unterstellt, dass für den Wärmepumpenhochlauf unter anderem ein finanzieller Anreiz existieren muss. Um für diese Bedingung den notwendigen Förderbedarf nachvollziehbar abschätzen zu können, wird angenommen, dass
● sich Wartungskosten, Kosten für Hilfsenergie bei der Gas-Heizung, Schornsteinfeger und Versicherungen gegenseitig aufheben und
● ein hinreichender finanzieller Anreiz gegeben ist, wenn nach 15 Jahren (2025 bis 2039) Gesamtkostenparität erreicht wird.
Es werden somit für die Gas-Heizung die Kosten für den Brennstoff und separat die CO2-Kosten sowie eventuelle Investitionskosten und für die WP-Heizung zunächst nur die Stromkosten ermittelt. Die Differenz entspricht dem „maximal einsetzbaren Eigenkapital, abzüglich der Finanzierungskosten bzw. einer nicht erzielten Eigenkapitalrendite“ (Eigenkapitalbudget).
Ermittlung der Gesamtkosten
Dem Umstieg auf eine Wärmepumpen-Heizung gegenübergestellt werden drei Konfigurationen für die Gas-Heizung. Eine den älteren Bestand repräsentierende Gas-Heizung mit einem JNG von 0,85 (häufiger Status quo), eine bereits kürzlich erneuerte Gas-Heizung mit einem guten JNG von 0,93 und die Erneuerung einer Gas-Heizung mit einem JNG von ebenfalls 0,93. Der angenommene JNG ist ein in der Praxis mit Qualitätssicherung zu erreichender durchschnittlicher Bestwert (oberer Grenzwert).
Bei der Wärmepumpen-Heizung wird eine JAZ zwischen 3,0 und 4,6 in fünf Stufen abgebildet, was unterschiedliche Typen, Wärmequellen und Wärmeübergabesysteme berücksichtigt.
Ebenfalls zugunsten der Gas-Heizung wird angenommen, dass ihre Erneuerung bei 9000 kWh/a Nutzwärmebedarf 6500 Euro kostet und sich der Komplettpreis bis 22 500 kWh/a Nutzwärmbedarf linear auf 9500 Euro verteuert. Da die Investition zum Startzeitpunkt erfolgt, können abweichende Investitionskosten einfach bei der Gesamtkostendifferenz berücksichtigt werden.
Die Energie-Rechnungen werden mit 2 %/a auf den 1. Januar 2025 abgezinst. Alle laufenden Rechnungen und Kreditraten werden jeweils am Jahresende bezahlt, jedoch die Rechnung für den Umstieg auf eine neue Wärmepumpe oder die Aktualisierung der Gas-Heizung am 1. Januar 2025.
Gaspreis und Wärmepumpen-Strompreis
Es wird ein effektiver Gaspreis von 9,5 Ct/kWh im Jahr 2025 angenommen. Bereinigt um die CO2-Kosten sind es 8,31 Ct/kWh. Dieser Preisbestandteil unterliegt im Berechnungsmodell ab 2026 einer Teuerung von 2 %/a. Addiert werden in jedem Jahr die Kosten aus der CO2-Bepreisung.
Der effektive Wärmepumpen-Strompreis 2025 wird mit 21,85 Ct/kWh angenommen. Dies ist (analog zum Gaspreis) der im Januar 2025 im Bundesdurchschnitt angebotene Preis für WP-Stromtarife mit separatem Zähler und Modul 2. Der Strompreis verteuert sich im Berechnungsmodell um 2 %/a (wie bei den von den CO2-Kosten separierten Gaspreisbestandteilen).
Zur Vereinfachung wird angenommen, dass die im Gebäudeenergiegesetz hinterlegte Grüne-Brennstoff-Quote ab 2029 nicht anzuwenden ist1).

JV
CO2-Preis für Erdgas
Es wird angenommen, dass (jeweils netto) im Jahr 2026 der CO2-Preis bei 65 Euro/t liegt und ab 2027 jährlich in 5 Szenarien linear steigt.
● P00: der CO2-Preis steigt jährlich um 0 Euro/t
● P05: der CO2-Preis steigt jährlich um 5 Euro/t
● P10: der CO2-Preis steigt jährlich um 10 Euro/t
● P15: der CO2-Preis steigt jährlich um 15 Euro/t
● P20: der CO2-Preis steigt jährlich um 20 Euro/t
Beim gewählten Referenzszenario P15 liegt der CO2-Preis im letzten Jahr der Betrachtungszeit bei 260 Euro/t (und im Jahr 2044 bei 335 Euro/a). Auf die bei anderen Berechnungen von der TGA+E-Redaktion verwendete (politische) Limitierung auf 240 Euro/t wurde hier verzichtet. P20 erreicht im Jahr 2039 einen CO2-Preis von 325 Euro/a.
Nutzwärmebedarf 9000 kWh/a und JAZ von 4,2
Grafik 2 steht für ein Gebäude mit einem niedrigen Nutzwärmebedarf von 9000 kWh/a. Für das eingetragene Ablesebeispiel wurde angenommen, dass das (Niedertemperatur-)Wärmeübergabesystem eine Jahresarbeitszahl von 4,2 ermöglicht. Ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen Nutzwärmebedarf und dem Wärmeübergabesystem existiert allerdings nicht. Eine kleinere JAZ würde das Eigenkapitalbudget verringern.
In Grafik 2 und den folgenden Auswertung wird jeweils ein Bezug auf den Preispfad P15 vorgenommen. Er erscheint im Rahmen der Stellschrauben und Diskussionen im Zeitbereich bis Ende der 2030er-Jahre am plausibelsten zu sein. Gleichwohl kann heute niemand den CO2-Preispfad aufgrund nicht abzubildender Interaktionen vorhersagen. Allein eine gut begründete und glaubhaft vermittelte Prognose würde ihn schon verändern. Wichtig ist jedoch, die Auswirkung unterschiedlicher Preispfade zu kennen.
In dem betrachteten 15-Jahre-Zeitfenster würden bei der erneuerten Gas-Heizung die CO2-Kosten für einen Nutzwärmebedarf von 9000 kWh/a bzw. den zugehörigen Erdgasverbrauch von 9677 kWh/a bei P00, also einem Zertifikatpreis für einen Sockel von konstant 65 Euro/t, bei abgezinst 1720 Euro liegen. Mit dem steilen Anstieg von P20 würde er um den Faktor 2,78 auf 4790 Euro steigen.

JV
Für den kleinen Ausschnitt der drei eingetragenen (von 45 ablesbaren) Fälle liegt das Eigenkapitalbudget (gerundet auf volle 50 Euro) zwischen 8950 Euro und 15 450 Euro. Zwei Situationen sind besonders relevant:
Der Vergleich mit der alten Gas-Heizung ergibt ein Eigenkapitalbudget von immerhin 10 450 Euro. Mit der schon betagten Gas-Heizung resultiert es jedoch aus der Annahme, dass die Heizung nie erneuert werden muss. Das ist zwar falsch, aber der Blickwinkel des Heizungsbetreibers.
Der korrekte Vergleich findet sich somit nur auf der rechten Seite und würde dann inklusive im Vergleich zur Erneuerung der Gas-Heizung bei 15 450 Euro liegen (Fall A). Dies ist für den Betreiber der günstigste Fall, eine spätere Modernisierung führt zu höheren Gesamtkosten2).
Ist die Gas-Heizung erst kürzlich erneuert worden, ergibt sich durch den besseren Jahresnutzungsgrad ein Eigenkapitalbudget von 8950 Euro (Fall B). Wichtig: Es verändert sich nicht, wenn die Gas-Heizung noch nicht „abgenutzt“ oder nicht abgezahlt ist. Das Abzahlen würde lediglich die Gesamtkosten beider Fälle erhöhen, jedoch nicht die Differenz zueinander, die das Eigenkapitalbudget ergibt. Oder anders ausgedrückt: Lässt sich mit dem Eigenkapitalbudget von 8950 Euro der Umstieg auf eine Wärmepumpen-Heizung realisieren, lohnt es sich, die gerade erst erneuerte Gas-Heizung aufzugeben. Ob eine zeitweise Hybridisierung oder eine andere Lösung wirtschaftlicher wäre, soll hier nicht erörtert werden.
Die relevante Spannbreite für das Eigenkapitalbudget ergibt sich somit aus dem Minimal- und Maximalwert. Welchen tatsächlichen Wert sie haben, wird unter Grafik 3 und 4 erläutert.
Den Kosten für „Gas P20 093“ von 23 100 Euro sollte man besondere Beachtung schenken: Soviel dürfte eine Wärmepumpe den Gebäudebesitzer für Gesamtkostenparität kosten, wenn die Finanzierungskosten null sind und der Strom umsonst ist (die JAZ hat dann keinen Einfluss mehr). Die Zuspitzung verdeutlicht, dass Einzelanlagen mit sehr geringem Nutzwärmebedarf bei einer schnellen Abschaffung der Heizungsförderung mit klassischen Wärmepumpenlösungen auf dem aktuellen Preisniveau kaum noch zu erschließen wären.
Nutzwärmebedarf 13 500 kWh/a und JAZ von 3,8
Grafik 3 repräsentiert ein Gebäude mit einem Nutzwärmebedarf von 13 500 kWh/a. Das eingetragene Ablesebeispiel unterstellt eine Jahresarbeitszahl von 3,8. Eine kleinere JAZ würde das Eigenkapitalbudget verringern, eine größere würde es erhöhen.
Wie zuvor erläutert, beträgt für die Parameterauswahl das relevante Eigenkapitalbudget 12 350 Euro bzw. 19 850 Euro.

JV
Aus dem Eigenkapitalbudget sind auch die Finanzierungskosten bzw. (fiktiv) eine Eigenkapitalrendite zu bestreiten. Um das tatsächlich verfügbare Investitionsbudget festzustellen, müssen die Finanzierungskosten bzw. die Eigenkapitalrendite ermittelt werden.
Bei der Eigenkapitalrendite lässt es sich mit dem Betrachtungszeitraum von 15 Jahren und einem gewählten Zinssatz (der auch alle Abzüge berücksichtigt, „echt-effektiv“) mit einfachen Zinsformeln berechnen. Bei einem Zinssatz von 3 % würde sich angelegtes Kapital um den Faktor 1,51 erhöhen. Ohne Abzinsung müsst dann das Eigenkapitalbudget durch diesen Faktor geteilt werden. Mit der oben angegebenen Abzinsung von 2 %/a verringert sich der Faktor auf rund 1,124. Dem Gebäudebesitzer steht somit nur rund 89 % vom Eigenkapitalbudget als Investitionsbudget zur Verfügung: 11 000 Euro bzw. 17 650 Euro. Bei der CO2-Preiskurve P00 wären es jeweils rund 3050 Euro weniger.
Unter Grafik 4 wird exemplarisch das Eigenkapitalbudget mit einer Kreditfinanzierung berechnet.
Nutzwärmebedarf 18 000 kWh/a und JAZ von 3,4
Grafik 4 repräsentiert den typischen Referenzfall eines Einfamilienhauses mit einem Gasverbrauch von 20 000 kWh und einem Jahresnutzungsgrad von 0,9 und einem Nutzwärmebedarf von 18 000 kWh/a. Das eingetragene Ablesebeispiel unterstellt eine Jahresarbeitszahl von 3,4. Sie steht exemplarisch für die Realisierung mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe und eine Optimierung der Vorlauftemperatur auf maximal 50 °C bei einer Norm-Auslegungstemperatur von − 12 °C.
Wie zuvor erläutert, beträgt für die Parameterauswahl das relevante Eigenkapitalbudget 14 700 Euro bzw. 23 200 Euro. Gegenüber der mit echt-effektiv 3 %/a verzinsten Kapitalanlage ergibt sich ein Investitionsbudget von 13 050 Euro bzw. 20 650 Euro. Bei der CO2-Preiskurve P00 wären es jeweils rund 4100 Euro weniger.

JV
Häufig steht allerdings kein Eigenkapital zur Verfügung oder ist langfristig oder für einen bestimmten Zweck angelegt. Für die Fremdfinanzierung werden zwei Fälle mit einer Laufzeit von 15 Jahren und einem verbilligten Zinssatz von effektiv 1 % (halber Wert für die Abzinsung / Inflation) und von effektiv 5 % (2,5-facher Wert für die Abzinsung) betrachtet. Beim verbilligten Zinssatz von 1 % ist dann das Eigenkapitalbudget mit 1,079 und beim mit 5 % verzinsten Annuitätendarlehen mit 0,808 zu multiplizieren.
Das Investitionsbudget liegt dann im Vergleich zur schon sanierten Gas-Heizung bei 15 850 Euro (1 %/a) oder 11 850 Euro (5 %/a). Gegenüber der noch zu sanierenden Gas-Heizung beträgt das Investitionsbudget 25 050 Euro (1 %/a) oder 18 750 Euro (5 %/a).
Exkurs: Beim verbilligten Zinssatz von 1 % wird ein Annuitätendarlehen von 1000 Euro mit einer Zahlung von rund 72,2 Euro pro Jahr (einmalige Zahlung am Jahresende) innerhalb von 15 Jahren abbezahlt, bei einem Zinssatz von 5 % sind es 96,4 Euro pro Jahr.
Nutzwärmebedarf 22 500 kWh/a und JAZ von 3,0
Grafik 5 steht für ein älteres unsaniertes Einfamilienhaus. Das Ablesebeispiel geht mit einer Jahresarbeitszahl von 3,0 von einem noch nicht optimierten Wärmeübergabesystem und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe aus. Eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 ist ein Kriterium für die BEG-EM-Heizungsförderung.

JV
Für die Parameterauswahl beträgt das relevante Eigenkapitalbudget 15 550 Euro bzw. 25 050 Euro. Gegenüber der mit echt-effektiv 3 %/a verzinsten Kapitalanlage ergibt sich ein Investitionsbudget von 13 800 Euro bzw. 22 250 Euro. Bei der CO2-Preiskurve P00 wären es jeweils rund 5100 Euro weniger.
Bei einer Kreditfinanzierung liegt das Investitionsbudget im Vergleich zur schon sanierten Gas-Heizung bei 16 750 Euro (1 %/a) oder 12 550 Euro (5 %/a). Gegenüber der noch zu sanierenden Gas-Heizung beträgt das Investitionsbudget 27 000 Euro (1 %/a) oder 20 250 Euro (5 %/a).
Ermittlung des Förderbedarfs
Um den rechnerisch erforderlichen Förderbedarf für Gesamtkostenparität nach 15 Jahren zu bestimmen, müssen Installationskosten für den Umstieg auf eine Wärmepumpe festgelegt werden. Sie beinhalten aufgrund der angenommenen Modul-2-WP-Strompreise die Einrichtung eines separaten Zählpunkts für die Wärmepumpe. In den nachstehenden Tabellen sind für projekt- und lösungsspezifische Unterschiede zwei unterschiedliche Installationskosten angegeben. Wie die Installationskosten der Gas-Heizung (Zeilen 4 bis 14) gehen sie durch die Modellfestlegung ohne Abzinsung in die Berechnung ein. Die Werte in den Zeilen 9 bis 11 sowie 19 bis 21 können dadurch einfach an andere Bedingungen angepasst werden.
Der untere Wert für die Installationskosten mag auf den ersten Blick zu optimistisch erscheinen. Für eine Bedarfsanalyse sind jedoch nicht aktuelle Marktpreise maßgebend, da sie – das ist der Anlass für die Diskussion – von der Heizungsförderung selbst beeinflusst sind.

JV
Tabelle 1 zeigt für den geringen Nutzwärmebedarf von 9000 kWh/a und die CO2-Preiskurve P15 den Förderbedarf für die beiden als relevant eingeordneten Ausgangssituationen. Im gewählten Bereich der JAZ variiert er im Fall A bei den niedrigen Installationskosten gegenüber dem Einsatz von Eigenkapital (Zeile 9) zwischen 10 700 Euro und 7700 Euro. Der prozentuale Bedarf (Zeile 12) liegt in dem von der BEG EM zur Verfügung gestellten Bereich inklusive Klimageschwindigkeits-Bonus. Beim Fall B liegt der Förderbedarf um 6500 Euro höher, dies entspricht den Installationskosten für die Gas-Heizung. Da der Fall B keinen Anspruch auf den Klimageschwindigkeits-Bonus hat, sind die von der BEG EM zur Verfügung gestellten Zuschüsse (Fördersätze) für eine Gesamtkostenparität nach 15 Jahren nicht ausreichend.
Nimmt man für den Fall B überschlägig 60 % der in den letzten fünf Jahren neu eingebauten Gas-Brennwertheizungen an, betrifft er etwa 1,6 Mio. Heizungsanlagen. Bezogen auf die letzten 19 Jahre wären es mit der gleichen Systematik etwa 5 Mio. mit Gas betriebene Heizungsanlagen.

JV
In Tabelle 2 für einen Nutzwärmebedarf von 13 500 kWh/a und wieder die CO2-Preiskurve P15 variiert der Förderbedarf im gewählten Bereich der JAZ im Fall A bei den niedrigen WP-Installationskosten gegenüber dem Einsatz von Eigenkapital (Zeile 9) zwischen 9050 Euro und 4550 Euro breiter und niedriger als in Tabelle 1. Der prozentuale Bedarf (Zeile 12) liegt in dem von der BEG EM zur Verfügung gestellten Bereich, zum Teil auch ohne Klimageschwindigkeits-Bonus. Beim den höheren WP-Installationskosten gegenüber dem Einsatz von Eigenkapital (Zeile 9) ist ein Zuschuss oberhalb der Grundförderung notwendig.
Beim Fall B liegt der Förderbedarf um 7500 Euro höher, dies entspricht den Installationskosten für die Gas-Heizung. Da der Fall B keinen Anspruch auf den Klimageschwindigkeits-Bonus hat, sind die von der BEG EM zur Verfügung gestellten Zuschüsse (Fördersätze) für eine Gesamtkostenparität nach 15 Jahren nicht ausreichend.

JV
In Tabelle 3 für einen Nutzwärmebedarf von 18 000 kWh/a und wieder die CO2-Preiskurve P15 variiert der Förderbedarf im gewählten Bereich der JAZ im Fall A bei den niedrigen WP-Installationskosten gegenüber dem Einsatz von Eigenkapital (Zeile 9) zwischen 8400 Euro und 2400 Euro noch breiter und niedriger, denn mit steigendem Nutzwärmebedarf vergrößert sich der absolute Kostenvorteil eine Wärmepumpe. Der prozentuale Bedarf (Zeile 12) liegt im oder unter dem von der BEG EM zur Verfügung gestellten Bereich, zum Teil auch unter der Grundförderung. Auch bei den höheren WP-Installationskosten von 32 000 Euro liegen sie beim Einsatz von Eigenkapital (Zeile 9) bei den höheren JAZ im Bereich der Grundförderung.
Beim Fall B liegt der Förderbedarf um 8500 Euro höher, dies entspricht den Installationskosten für die Gas-Heizung. Da der Fall B keinen Anspruch auf den Klimageschwindigkeits-Bonus hat, sind die von der BEG EM zur Verfügung gestellten Zuschüsse (Fördersätze) für eine Gesamtkostenparität nach 15 Jahren nur bei niedrigen Installationskosten und einer sehr hohen JAZ ausreichend.

JV
In Tabelle 4 für einen Nutzwärmebedarf von 22 500 kWh/a und wieder die CO2-Preiskurve P15 variiert der Förderbedarf im gewählten Bereich der JAZ im Fall A bei den niedrigen WP-Installationskosten gegenüber dem Einsatz von Eigenkapital (Zeile 9) zwischen 7750 Euro und 250 Euro noch breiter und niedriger, denn mit steigendem Nutzwärmebedarf vergrößert sich der Kostenvorteil eine Wärmepumpe. Der prozentuale Bedarf (Zeile 12) mit 26 % bis 1 % zeigt eine Überförderung bei den angenommenen WP-Installationskosten an. Die gilt auch bei Installationskosten von 36 000 Euro.
Beim Fall B liegt der Förderbedarf um 9500 Euro höher, dies entspricht den Installationskosten für die Gas-Heizung. Da der Fall B keinen Anspruch auf den Klimageschwindigkeits-Bonus hat, sind die von der BEG EM zur Verfügung gestellten Zuschüsse (Fördersätze) für eine Gesamtkostenparität nach 15 Jahren nur bei niedrigen Installationskosten und hohen JAZ ausreichend.
Anmerkungen
● Die großen Unterschiede beim ermittelten Förderbedarf zeigen, dass die BEG EM im Rahmen der gewählten Parameter in wichtigen Fallgruppen parallel ungenügend, ausreichend und zu viel Zuschuss anbietet.
Vergleicht man in den Tabellen 1 bis 4 oben links die Zellen E9 (Fall A; JAZ 3,4; FB KA 3 %), sinkt der Förderbedarf mit steigendem Nutzwärmebedarf: 9700 Euro; 7500 Euro; 6350 Euro; 5200 Euro.
In der korrespondierenden Zelle E12 ergibt sich ein prozentualer Förderbedarf von 44 %; 31 %; 24 %; 17 %.
Vergleicht man in den Tabellen 1 bis 4 unten links die Zellen E19 (Fall B; JAZ 3,4; FB KA 3 %), steigt der Förderbedarf mit steigendem Nutzwärmebedarf: 15 450 Euro; 14 200 Euro; 13 950 Euro; 13 650 Euro.
In der korrespondierenden Zelle E22 ergibt sich ein prozentualer Förderbedarf von 70 %; 59 %; 52 %; 46 %.
Der geringste Förderbedarf entsteht erwartungsgemäß, wenn eine ohnehin anstehende Heizungserneuerung für den Umstieg auf eine Wärmepumpe genutzt wird. Die absolute Höhe variiert deutlich geringer als der prozentuale Bedarf. Noch ausgeprägter ist dies beim Fall B – bei dem der Förderbedarf durch die nicht mehr gegenzurechnenden Investitionskosten für die Erneuerung der Gas-Heizung höher ist.
● Alle oben gewählten Parameter und Eingangsgrößen sind notwendige Annahmen und durch diesen Umstand diskutierbar. Für den Fall A zeigt sich, dass die aktuelle BEG EM den Förderbedarf in vielen Fällen gut abdeckt, zum Teil sogar überfördert wird. Im Umkehrschluss deutet sich damit an, dass die finanziellen Chancen der Heizungswende mit BEG-EM-Unterstützung nicht in der Breite bekannt sind und /oder weitere Hürden existieren, beispielsweise bei der Mobilisierung von Eigenkapital.
● Auch bei einem anderen Parameterset gilt, dass das Eigenkapitalbudget mit dem Nutzwärmebedarf, dem mittleren CO2-Preis sowie der Jahresarbeitszahl steigt und mit dem Unterschied zwischen Erdgas und WP-Strom steigt.
● Ein wesentlicher Bestandteil der Heizenergiepreise sind die lokalen Netznutzungsentgelte. Auch durch diesen Umstand kann (wird) im Einzelfall das Eigenkapitalbudget deutlich von hier getroffenen Annahmen abweichen, ein möglicher Ausblick wird hier beschrieben: Wo ein WP-Strom-/Gaspreisverhältnis unter 2 schon Realität ist
● In den Tabellen 1 bis 4 kann auch der WP-Strompreis indirekt variiert werden. Geht man beispielsweise von der mittleren JAZ von 3,8 (Spalte F) aus, repräsentiert Spalte D bei einer JAZ von 3,8 einen WP-Strompreis von
3,8 / 3,0 × 21,85 Ct/kWh = 27,68 Ct/kWh (+5,83 Ct/kWh)
und Spalte H bei einer JAZ von 3,8 einen WP-Strompreis von
3,8 / 4,6 × 21,85 Ct/kWh = 18,05 Ct/kWh (−3,80 Ct/kWh)
Dann zeigt sich, dass die Wirkung einer Strompreissenkung insbesondere bei geringem Nutzwärmebedarf (mutmaßlich) überschätzt wird.
● Mit der 20-Jahre-alt-Regelung für Gas-Heizungen selbstnutzender Gebäudeeigentümer wollte der Fördermittelgeber das Budget auf die Heizungsanlagen lenken, bei denen die höchste Gaseinsparung erzielt werden kann. Zum Entstehungszeitpunkt der BEG-EM-2024 mit begrenzten Mitteln und einer sehr hoch eingeschätzten Nachfrage bei der Heizungsförderung war dies auch plausibel. Aufgrund der tatsächlich eingetretenen Nachfrage könnte sich eine Lockerung positiv auf die Wärmewende auswirken.
● Je nach CO2-Preiskurve unterscheidet sich der Förderbedarf erheblich. Tabelle 5 verdeutlich dies für eine JAZ von 3,4 und einen Nutzwärmebedarf von 18 000 kWh/a. Da der CO2-Preis grundsätzlich unbekannt ist, müssen Heizungsmodernisierer auf die CO2-Preisentwicklung wetten und der Fördermittelgeber wird rückblickend eventuell feststellen, dass er zu großzügig gefördert hat. Siehe auch: Warum der Wärmepumpenhochlauf gefördert werden muss

JV
● Der hier ermittelte Förderbedarf zeigt – was oft gegenteilig diskutiert wird –, dass Wärmepumpen im Ein- und Zweifamilienhaussegment bei einem höheren Nutzwärmebedarf wirtschaftlicher als bei einem niedrigen Nutzwärmebedarf sind. Das berücksichtigt zwar Rückkopplungen durch Heizgrenze, Thermische Behaglichkeit (insbesondere Qualität der Fenster) und ein Absinken der Raumtemperatur bei gedrosselter Heizleistung zur Flexibilisierung des Stromverbrauchs und den Anteil für Trinkwassererwärmung nicht. Jedoch hat der Mythos, dass eine Wärmepumpe nur nach Sanierung der Gebäudehülle sinnvoll und wirtschaftlich ist, dem Interesse am Umstieg auf eine Wärmepumpe bis heute erheblich geschadet.
● In den Tabellen 1 bis 5 mit einem verbilligten Zinssatz von 1 % (Zeile 11) ergibt sich gegenüber dem Einsatz von verzinstem Eigenkapital (Zeile 9) ein deutlich verringerter Förderbedarf. Die zusätzlichen Kosten für den Fördermittelgeber sind hier allerdings nicht sichtbar. Wird der Zugang zu solchen Krediten vereinfacht, könnte dies die Nachfrage erhöhen – insbesondere, wenn das Produkt auch eine Zwischenfinanzierung von Handwerkerrechnungen obsolet macht.
● Wenn der Istzustand eine betagte Gas-Heizung ist, sind ihre laufenden Kosten kein geeigneter Vergleich für die Wirtschaftlichkeit. Der richtige Vergleich ist ein Heizsystem mit einer Restnutzungsdauer von mehr als 10 Jahren bzw. ein erneuertes Heizsystem. Ist die vorhandene Heizungsanlage noch nicht bezahlt, hat dies auf den Vergleich mit einer vorzeitigen Heizungserneuerung keinen Einfluss; die Restkosten erhöhen in beiden Fällen die Gesamtkosten in gleichem Umfang, sodass die Gesamtkostendifferenz nicht verändert wird. ■
Quelle: BEG EM, eigene Berechnungen / jv
1) Wie groß der sich aus der im GEG 2024 hinterlegten Quote für grüne Brennstoffe ergebende Kostenunterschied ist, ließe sich aufgrund komplexer Abhängigkeiten heute nur mit hoher Unsicherheit abschätzen. Die Logik der Preisbildung lässt aber erwarten, dass eine Grüne-Brennstoff-Quote (GEG 2024: ab 1. Januar 2029 mindestens 15 %, ab dem 1. Januar 2035 mindestens 30 % grüne Brennstoffe) das Heizen mit Gas verteuert. Weitere Informationen: Wie stark die Grüne-Brennstoff-Quote Gas verteuern könnte
2) Warten kostet: Wie teuer Zögern bei der Heizungswende ist